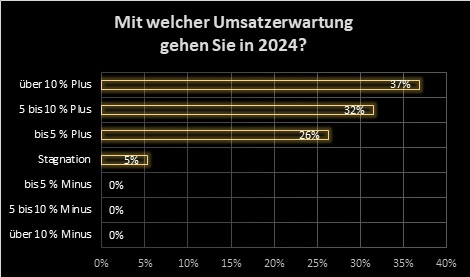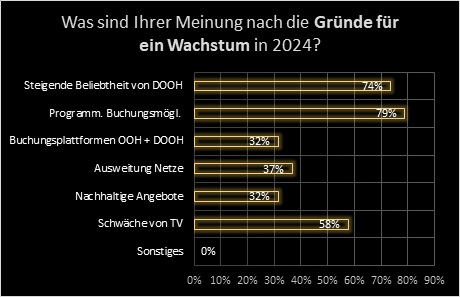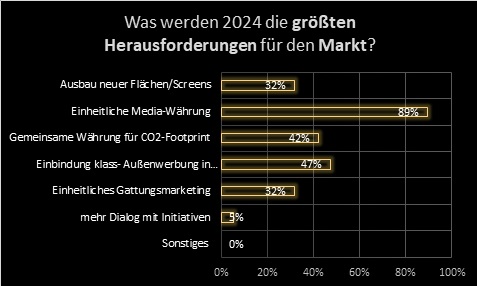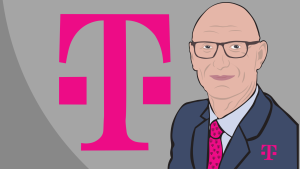Studie: Allianz-Chef Oliver Bäte ist Deutschlands erfolgreichster
DAX-CEO im Social Web
Die Kommunikation der DAX-CEOs auf LinkedIn, Instagram und Twitter

Allianz-Chef Oliver Bäte ist Deutschlands erfolgreichster DAX-40-Konzernchef im Social-Web. Auf den Plattformen LinkedIn und Instagram kommuniziert er in Summe deutlich besser als die Konkurrenz und stößt damit Christian Klein (SAP) vom Thron. Das legt jetzt die aktuelle Auflage des „Social CEO-Checks“ offen – der gemeinsam von der Kommunikationsagentur cocodibu mit der Hochschule Macromedia herausgegeben wird.
Der „Social CEO-Check“ analysiert die Content-Quantität sowie -Qualität der DAX-CEOs auf den relevanten Social Kanälen LinkedIn, Instagram und X (ehem. Twitter). Kriterien hierfür sind die jeweiligen Followerzahlen der Vorstandsvorsitzenden (Audience), das Feedback, also Reaktionen, Kommentare und Views der Follower (Buzz) sowie auch die Anzahl ihrer Posts (Commitment) im Zeitraum von 1. Januar bis 31. Dezember 2023. Die Einzelwerte der Plattformen hat die Macromedia dabei per Algorithmus ausgewertet, gewichtet und zu einem Gesamtranking verdichtet. Die an der maromedia entwickelte wissenschaftliche Analyse „ABC Social Media Impact Analysis“ fand bereits bei den drei Vorgängerstudien aus den Jahren 2019, 2020 und 2021 Anwendung. Neu ist die Grundgesamtheit: Aufgrund von Wechseln in der DAX-Zusammensetzung, sind diesmal erstmals 43 Konzern-CEOs analysiert worden.
Oliver Bäte gewinnt mit Followerzahl und Interaktionen
Dank einer beeindruckenden Steigerung seines Gesamtwertes um +2,6 Punkte gegenüber dem Vorjahr, steht der Vorstandsvorsitzende der Allianz Oliver Bäte an der Spitze der jüngsten Ausgabe des „Social CEO-Checks“. In der letzten Studie von 2021 stand er noch auf Platz 8 des Rankings. Auf einer Skala von -10 (sehr schlecht) bis +10 (sehr gut) liegt Bäte mit einem Gesamtrating von +3,3 eindeutig auf dem ersten Platz, vor allem dank seines überdurchschnittlich erfolgreichen Auftritts auf der Plattform LinkedIn. Besonders auffällig sind der Anstieg seiner Followerzahl und deren Interaktion auf dem Profil. Nur seine relativ wenigen Posts gelten im Vergleich als quantitativ ausbaufähig.
Den zweiten Platz teilen sich Markus Krebber von RWE, Roland Busch (Siemens) und Martin Brudermüller (BASF). Die Kommunikationsstrategien der ersten beiden CEOs unterscheiden sich dabei grundsätzlich: Während Krebber nur LinkedIn nutzt und hier seine Kommunikation intensivierte, setzt Busch zusätzlich auf die Plattformen Instagram und X. Als einziger der Top drei CEOs nutzt er damit alle drei Social-Kanäle. Spitzenwerte erziele er auf X mit dem Commitment, also der Anzahl der Beiträge (+ 2,3 Punkte im Vergleich zu 2021) und dem Buzz, der Interaktion, auf Instagram (+ 0,8 Punkte).
Insgesamt verzeichnen zwölf der 18 CEOs, bei denen Vergleiche zu den Vorjahren möglich waren, einen Aufwärtstrend. An der Spitze der Gesamtverbesserung liegt Martin Brudermüller (BASF) mit einer absoluten Veränderung von 12,7 Punkten seit 2019 (von -10 auf +2,7). Brudermüller, der allein LinkedIn nutzt, konnte in dieser Zeit gleichermaßen Audience und Commitment deutlich steigern.
„Unsere Analyse zeigt die wachsende Bedeutung der CEO-Kommunikation. Die Rolle der Vorstandsvorsitzenden im Social Web ist mehr als nur Präsenz; sie ist eine fortlaufende Verpflichtung, der sich eigentlich kein CEO entziehen kann. Sie sind die glaubwürdigsten Markenbotschafter und Corporate-Influencer, die ganz entscheidend die öffentliche Wahrnehmung und das Vertrauen in das Unternehmen stärken können“, so Studienleiter Prof. Oliver T. Hellriegel von der Hochschule Macromedia.
Doch nicht jedem gelingt der kommunikative Auftritt im Social Web: Thierry Bernard von QIAGEN hat einen beträchtlichen Rückgang um -4,7 Punkte zu verzeichnen, was ihn mit einem Rating von
-3,9 ans Tabellenende bringt. In allen drei Kennzahlen liegt er deutlich unter dem Durchschnitt. Die stärkste und gleichzeitig drastische Verschlechterung legt Oliver Blume (Volkswagen) mit einer Differenz von -12,4 hin. Der Grund: In den Jahren zuvor lag sein Kommunikationsverhalten von 2019 bis 2021 durchgehend im überdurchschnittlichen Bereich, bis 2023 plötzlich keine Aktivität mehr verzeichnet wurde.
„Der ‚Social CEO-Check‘ spiegelt im Zeitablauf die gestiegene Bedeutung der CEO-Kommunikation wider und letztlich auch die veränderte Medienwirklichkeit; zugleich aber auch die Risiken, die damit verbunden sind. Sie kann eben auch zum Bumerang werden, wenn etwa auf LinkedIn salbungsvoll über Nachhaltigkeit doziert wird, zugleich aber in den Medien ein Umweltskandal aufpoppt“, erklärt cocodibu-Geschäftsführer Stefan Krüger.
Hohe Werte in mindestens zwei Kategorien entscheiden über den Erfolg
Während 2021 noch ein Drittel aller DAX CEOs gar keine Social Media Präsenz hatte, sind es 2023 nur 3 von 43 CEOs, der 40 gelisteten DAX-Unternehmen. 31 von 43 CEOs sind auf der Social Media Plattform LinkedIn aktiv, vier auf Instagram und sieben auf X. Im Jahr 2021 waren es nur 23 aktive Profile auf LinkedIn. Das unterstreicht die Bedeutung von LinkedIn für die CEO-Kommunikation, doch allein das reicht für den Erfolg nicht aus: Obwohl Leonhard Birnbaum (E.ON) bei LinkedIn den höchsten Commitment-Wert (Anzahl der Post) hat, landet er wegen einer vergleichsweise kleinen Followerschaft (und schwacher Interaktion) nur auf Platz 15. Ähnlich bei Adidas-Chef Bjørn Gulden: Er erhält den höchsten Buzz-Wert, landet dennoch weit hinten im Ranking (Platz 29) durch seine sehr niedrige Audience und Commitment Werte.
Nur eine Minderheit auf Instagram und X erfolgreich
In seiner Kommunikation setzt Bjørn Gulden stattdessen auf Instagram: Hier erreicht er einen sehr hohen Audience-Wert sowie einen überdurchschnittlichen Commitment-Wert und liegt damit auf dem zweiten Platz im Instagram Ranking. Schon seit 2021 ist er in den Top 2 der Social-CEOs vertreten – damals noch als Chef von Puma. Roland Busch ist das erste Mal im Top 3 Instagram-Ranking dabei. Platz 1 beansprucht Timotheus Höttges (Deutsche Telekom) für sich – mit einem Wert von +3,1 im Instagram Ranking. Gulden und Höttges sind die einzigen Konzernchefs mit positiven Werten auf dieser Plattform. Auch auf X ist nur eine Minderheit vertreten und auch erfolgreich – ein Indiz für die schwindende Relevanz des Kanals: Allein Busch und Guillaume Faury (Airbus, Platz 1) durchliefen eine positive Entwicklung im X-Ranking über die Jahre. Der Beständigste CEO ist hier Christian Klein: In allen vier Jahren ist er bei X in den Top 3 vertreten.
„Mit dem Social CEO-Check haben wir schon vor fünf Jahren ein differenziertes Verfahren zur Analyse der Kommunikation von Vorstandsvorsitzenden etabliert. Es bewertet die Erfolgsfaktoren für den Dialog in verschiedenen Sozialen Medien und kombiniert diese zu einem plattformübergreifenden Gesamtranking. In Summe zeigt sich, dass bei vielen das Zusammenspiel aus Audience, Buzz und Commitment noch deutlich ausbaubar ist,“ resümiert Prof. Dr. Dr. Castulus Kolo, Präsident der Hochschule Macromedia die Studie.
Über die Hochschule Macromedia
Die Hochschule Macromedia ist eine an acht deutschen Standorten tätige, private Hochschule mit fast 6.000 Studierenden und etwa 150 Professorinnen und Professoren. Die Hochschule Macromedia und ihre Schwesterinstitution, die Macromedia Akademie, sind Teil der internationalen Bildungsgruppe Galileo Global Education. Dort agieren wir in einem Netzwerk von 54 Bildungseinrichtungen mit insgesamt gut 200.000 Studierenden an 91 Campus in 15 Ländern. Diese Internationalität prägt auch die Kultur an den Macromedia-Standorten. Bis zu 80 verschiedene Nationalitäten durften wir in unseren Studienjahrgängen bereits begrüßen.
Insgesamt beinhaltet das Studienangebot der Hochschule Macromedia ein breit gefächertes Portfolio staatlich anerkannter Bachelor- und Masterabschlüsse in deutscher und englischer Sprache, aktuell 16 Studiengänge mit über 100 akkreditierten Vertiefungsrichtungen.
Thematische Schwerpunkte des Studienangebots liegen in den Bereichen Medien, Management und Kommunikation, Digitale Technologien, Coding und Design, Sport, Psychologie, Games, Journalismus, Film, Fashion, Musik und Schauspiel. Jeder Bereich ist mit internationaler Forschung bzw. Kunstausübung verbunden und speist unseren Wissenstransfer in die Wirtschaft.
www.hochschule-macromedia.de